Im Jahr 1891 schrieb Oscar Wilde in seinem Essay »Der Sozialismus und die Seele des Menschen«: »Heutzutage wird sehr viel Unsinn über die Würde der körperlichen Arbeit geschrieben. An der körperlichen Arbeit ist ganz und gar nichts notwendig Würdevolles (…). Es ist geistig und moralisch genommen schimpflich für den Menschen, irgendetwas zu tun, was ihm keine Freude macht, und viele Formen der Arbeit sind ganz freudlose Beschäftigungen.« Hätte sich die Linke in den vergangenen 100 Jahren stärker an Oscar Wildes Schrift orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist moralinsauren Vordenker zu reproduzieren, hätte sie gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel nicht erfüllt, sondern fertigmacht. Sie würde nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, sondern skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft solch eine ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung zu keiner Befreiung führt.
Was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht? Und was sind das für Menschen, die angesichts der Einrichtung dieser Welt nicht mit aller Leidenschaft für jenes ganz Andere streiten, das es den Individuen ermöglichen könnte, sich in Ausschweifung und Genuss, geistiger und körperlicher Hingabe, Kunst und intellektueller Selbstreflexion als Gattungswesen überhaupt erst zu konstituieren? Es ginge darum, sich die Welt im wie auch immer widersprüchlichen Einklang mit den Mitmenschen und mit der größtmöglichen Bequemlichkeit anzueignen. Das hieße unter anderem: Transformation des Privateigentums an Produktionsmitteln hin zu gesellschaftlicher Verfügung zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit. Nicht aus Hass auf die Reichen oder gar den Reichtum, sondern wegen der Beschränkungen der menschlichen Entfaltung, die solche Formen von Eigentum zwangsläufig mit sich bringen und selbst noch den Besitzenden auferlegen. Es ginge um eine von Ausbeutung und Herrschaft befreite Gesellschaft, nicht zum Zwecke der Konstitution repressiver Kollektive oder gar der Rückkehr zu irgendeiner vermeintlich »natürlichen«, vorzivilisatorischen Lebensweise, sondern zur Befreiung der Individuen aus jenen gesellschaftlichen Zwängen, die angesichts des gesellschaftlichen Reichtums vollkommen anachronistisch sind.
Doch statt für die Bedingungen der Möglichkeit individueller Freiheit und gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, für einen produktiven Müßiggang, der das Gegenteil von auf die Dauer nur Langeweile verströmendem Nichtstun wäre, sucht man in der Schinderei der Arbeit Erfüllung – und findet sie womöglich auch noch. Der Papst verkündet, die Arbeit trage dazu bei, »Gott und den anderen näher zu sein«. Bei der NPD firmiert »Arbeit« noch vor »Familie« und »Vaterland«, die Freiheitliche Partei in Österreich forderte »Hackeln statt packeln« und linke Gruppen drohen ihren Gegnern in ihren reichlich abgehalfterten Demoparolen an, sie »in die Produktion« zu schicken. Wo sich Gewerkschaften zumindest innerhalb des schlechten Bestehenden als partiell vernünftig erweisen und wie die Schweizer Arbeitervertretung einen Volksentscheid zur Arbeitsminimierung initiieren, schlägt ihnen die geballte Arbeitswut der Mehrheitsbevölkerung entgegen: 66,5 Prozent der Eidgenossen stimmten vor wenigen Wochen in einem Referendum gegen die Verlängerung des gesetzlichen Mindesturlaubs von vier auf sechs Wochen.
Arbeitswahn und Antisemitismus
Die fanatischsten Lobpreiser der Arbeit waren schon immer zugleich die schlimmsten Antisemiten: Von Marin Luther, dem Vordenker des »protestantischen Arbeitsethos« und Autor des Pamphlets »Von den Juden und ihren Lügen«, über den Industriellen Henry Ford, den Autor des Machwerks »Der internationale Jude«, für den es »nichts Abscheulicheres« gab »als ein müßiges Leben«, bis zum Führer der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Hitler proklamierte in »Mein Kampf« den »Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird«. Wie ernst er das gemeint hatte, konnte man später über den Toren der Vernichtungslager nachlesen: »Arbeit macht frei«. Die Linke hingegen polemisierte gegen die schmarotzenden Müßiggänger und wünschte sich »Arbeiter- und Bauernstaaten«, anstatt die Menschen vom elenden Dasein als Arbeiter zu befreien. Der Arbeitsfanatismus links wie rechts sieht die ehrliche Arbeit um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die »Zinsknechtschaft« oder die keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten »Spekulanten«. Die Agitation geht gegen »die da oben«, gegen die »Bonzen und Parasiten«, die lieber konspirieren als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen.
Der Hass auf das unterstellte oder tatsächliche arbeitslose Einkommen ist nicht nur eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit und seiner Verherrlichung des Staats eine äußerst gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und ungleiche Reichtumsverteilung. Der in jedem arbeitsfetischistischen 1.Mai-Aufruf artikulierte Sozialneid ist das Gegenteil von dringend notwendiger Sozialkritik.
Ob linke Globalisierungsgegner, christliche Sozialtheoretiker oder faschistische Produktivitätsfanatiker: Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll für sie alle der Staat sein, der den zügellosen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit unmöglich machen soll. Kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Doch wird der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, werden Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. Es wird nicht das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des Interesses der abhängig Beschäftigten verantwortlich gemacht, sondern der Kapitalismus wird lediglich mit immer neuen sprachlichen Zusätzen versehen: vom »Turbokapitalismus« über den »Kasino- und Mafiakapitalismus« bis zum »Raubtierkapitalismus«. Dagegen wird dann die »Würde der Arbeit« ins Feld geführt und der Verlust der »Gestaltungsmöglichkeiten der Politik« beklagt.
Der Skandal der heutigen Gesellschaftsform besteht aber nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger Einfluss hat als früher (während sie in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Migrationsverwaltung, der an den europäischen Außengrenzen zahlreiche Menschen zum Opfer fallen, deutlich aktiver agiert als noch vor 20 Jahren). Das Niederschmetternde einer auf Gedeih und Verderb an die Verwertung von Kapital geketteten Gesellschaft besteht darin, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel »nachfragen«, aber eben über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen, achselzuckend in Kauf genommen wird. Das Obszöne dieser Gesellschaft besteht darin, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen auch in den materiell vergleichsweise abgesicherten Weltgegenden vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten nicht notwendig wäre. Nicht etwa, weil das irgendwelche finsteren Mächte so beschlossen hätten, sondern weil es schlicht der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht, gegen das es heute keine wahrnehmbaren Einwände mehr gibt – es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch eine noch schlimmere ersetzen wollen.
In den obligatorischen 1. Mai-Ansprachen, deren Inhalt in der Forderung »Arbeit, Arbeit, Arbeit« hinlänglich zusammengefasst ist, äußert sich moralische Empörung, aber keine Kritik, die sich zunächst einmal einen Begriff vom zu Kritisierenden machen müsste. Und so sehen dann auch die Rezepte aus. Beispielsweise jene des reformistischen Flügels der Antiglobalisierungsbewegung, die sich in Gruppierungen wie Attac als eine Art ideeller Gesamtsozialarbeiter konstituiert hat: Erst wird durchaus zutreffend das Elend in der Welt beschrieben – von den drastischen Verelendungstendenzen in den Metropolen bis zum Massensterben in den Hungerregionen. Doch dann fordert man angesichts dieses Leidens – eine neue Steuer. Mit Tobin-Tax und ähnlichem will man den »Auswüchsen« des »wurzellosen Finanzkapitalismus« zu Leibe rücken. Und so muss es einen auch gar nicht wundern, dass manche Verlautbarung der Globalisierungskritiker klingt, als wollten sie der nationalsozialistischen Unterscheidung in gutes »schaffendes« und böses »raffendes« Kapital das Wort reden. Doch auch in diesem Fall stehen Kapitalismuskritiker von links keinesfalls alleine da. In Österreich griff unlängst der Haus- und Hofdichter der Kronenzeitung diese Unterscheidung auf und reimte in der auflagenstärksten Tageszeitung des Landes: »Das Spekulantenpack ist schädlich, doch nicht das Kapital, das redlich.«
Diese Trennung ist keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern im Arbeitsfetischismus jeglicher Couleur angelegt: auf der einen Seite die Arbeitsplätze schaffenden, verantwortungsbewussten Industriekapitäne; auf der anderen das unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre, das in gemeinschaftsfeindlicher Absicht rastlos seine Krakenarme um den Globus spanne und die »Würde der Völker« angreife, zu deren Verteidigung nicht nur die lateinamerikanischen Linkspopulisten und Ahmadinejad-Freunde Hugo Chávez, Evo Morales und Daniel Ortega angetreten sind. Ein Paradebeispiel aus der Populärkultur für die Unterscheidung von bösem »raffenden« und gutem »schaffenden« Kapital bietet der Spielfilm »Pretty Woman«, worin der wurzellose Zirkulationskapitalist, in dem schon das Gute schlummert, das aber durch den schlechten Einfluss des geld- und machthungrigen Anwalts nicht zur Geltung kommen kann, von der schönen Prostituierten zum bodenständigen Produktionskapitalisten bekehrt und aus den Fängen des in jeder Hinsicht als unmoralisch gezeichneten Winkeladvokaten befreit wird.
In Europa werden sich auch zum diesjährigen 1. Mai Politiker aus fast allen Parteien zu leidenschaftlichen Anklagen gegen die »Spekulanten« und »Finanzhaie« aufschwingen. Gesellschaftskritik wurde schon längst durch die Benennung von vermeintlich Schuldigen ersetzt. Anstatt die gesellschaftlichen Gründe für das menschliche Elend ins Visier zu nehmen, werden Personifikationen der gesellschaftlichen Verhältnisse dem Volkszorn ausgeliefert. Anstatt für die Vollendung des Individualismus und für seine gesellschaftlichen Voraussetzungen zu streiten, klammert man sich auf den diversen 1. Mai-Aufmärschen an die Sklavenparole »Die Arbeit hoch!«. In der Huldigung des Prinzips der Arbeit finden Rechts und Links, sozialdemokratischer Etatismus und liberaler Verwertungswahn zueinander. Jemand wie Oscar Wilde hätte für dieses Theater nur Verachtung übrig gehabt. In »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« heißt es ebenso knapp wie treffend: »Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen.«
Glück statt Arbeit
Das zynische Achselzucken des Liberalismus, der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt erklärt, die Menschen seien nun einmal so, und der von seinen eigenen Konstitutionsbedingungen nichts wissen will, ist nicht viel besser als die linke Suche nach Schuldigen. Doch was sollte die Alternative zum traditionslinken wie liberalen Arbeitsfetischismus sein? Entspricht das Arbeitsregiment nicht der »menschlichen Natur«? Schon der Dandy und Gentleman Oscar Wilde hatte die passende Antwort auf derartige geschichtsvergessene Abwehrreaktionen parat: »Das einzige, was man von der Natur des Menschen wirklich weiß, ist, dass sie sich ändert.« Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und linken Staatsfetischismus ginge es um eine Kritik der Arbeit, die weder mit dem traditionellen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien etwas zu tun hat. Ihr geht es nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie will nicht Konsumverzicht, sondern Luxus für alle. Solch eine Kritik skandalisiert, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten nicht notwendig wäre. Für diese Vorenthaltung bedarf es nicht des bösen Willens von »Heuschrecken«, wie die Charaktermasken des Finanzkapitals, welche die vermeintliche Würde der Arbeit beschmutzen würden, in zahlreichen Reden am 1. Mai in eindeutiger Tradition wieder tituliert werden dürften, sondern allein der Logik eines Systems, das sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern der Verwertbarkeit des Kapitals orientiert.
Eine Kritik der Arbeit richtet sich nicht gegen das Glücksversprechen der bürgerlichen Revolution, sondern versucht, seinen ideologischen Gehalt aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass dieses Versprechen in der bürgerlichen Gesellschaft kaum eingelöst werden kann. Solcher Gesellschaftskritik will keinen falschen Kollektivismus oder gar Gemeinschaftssinn, sondern die verwirklichte Freiheit des Individuums, das sich seiner gesellschaftlichen Konstitution bewusst ist. Dementsprechend verachtet solch eine Kritik die Parole »Die Arbeit hoch!« und setzt dagegen die Vorstellung Theodor W. Adornos von einem befreiten gesellschaftlichen Zustand: »auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen«, was übrigens auch eine schöne Alternative zu den drögen Gewerkschaftsaufmärschen oder der Klassenkampfsimulation linker Splittergruppen am 1. Mai ist.
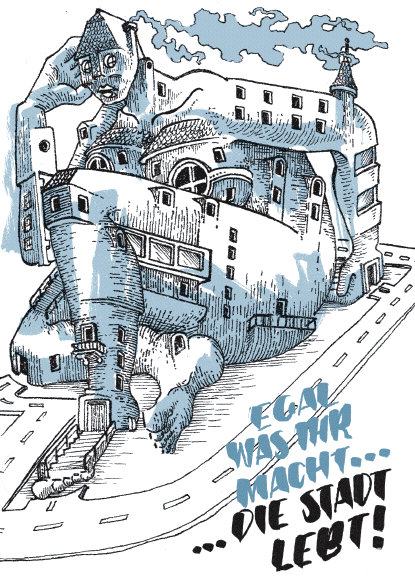 Umzug der Vorplatz-Weggewiesenen
Umzug der Vorplatz-Weggewiesenen







